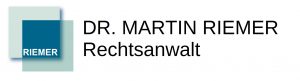Strafrecht: Darf ein Rechtsanwalt ein richterliches Votum veröffentlichen?
Stellen Sie sich vor, ein Rechtsanwalt führt einen Prozess und gelangt im Rahmen einer umfassenden Akteneinsicht an ein schriftliches Votum des Berichterstatters. Könnte dieser Rechtsanwalt dieses richterliche Votum auf seiner Website veröffentlichen, ohne mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen?
Das schriftliche Votum eines Berichterstatters ist der Öffentlichkeit und den betroffenen Prozessparteien normalerweise nicht zugänglich. Gemäß § 100 Abs. 4 VwGO ist das Votum als Arbeit zur Vorbereitung von Urteilen oder Beschlüssen von dem Recht auf Akteneinsicht ausgenommen. Dennoch kann es bei umfangreichen Akten geschehen, dass ein Votum in der Gerichtsakte abgeheftet wird und dann samt der Akte einem Rechtsanwalt im Rahmen der Akteneinsicht zur Verfügung gestellt wird.
Eine Strafbarkeit gemäß § 353b StGB scheidet hier von vornherein aus, da es sich bei dem Beratungsgeheimnis regelmäßig wohl nicht um ein wichtiges öffentliches Interesse handelt.[1]
Von vornherein ausgeschlossen werden kann eine Strafbarkeit nach § 203 StGB jedoch nicht. Danach ist strafbar, wer im Rahmen der Ausübung eines der aufgezählten Berufe von einem Privatgeheimnis Kenntnis erlangt und dieses offenbart. Der Rechtsanwalt wird in § 203 Abs. 1 Nr. 3 Var. 3 StGB als möglicher Täter genannt. Dem Rechtsanwalt ist der Inhalt des Votums in unserem Fall auch im Rahmen seiner Berufsausübung bekannt geworden und nicht als Privatperson (zur Problematik der Eigenvertretung eines Rechtsanwalts siehe unten). Würde der besagte Rechtsanwalt dieses Votum auf seiner Website veröffentlichen, würde er auch das Offenbarungserfordernis erfüllen. Strittig in einem solchen Fall ist lediglich, ob es sich bei dem Votum um ein Geheimnis im Sinne des § 203 Abs. 1 StGB handelt und ob in der Offenlegung durch das Gericht im Rahmen der Akteneinsicht eine ausdrückliche oder konkludente Einwilligung zur Offenbarung gesehen werden kann.
Einige Stimmen aus Literatur und Rechtsprechung vertreten die Auffassung, dass das schriftliche Votum des Berichterstatters unter das Beratungsgeheimnis fällt.[2] Das Beratungsgeheimnis wird seinerseits dann erfasst von der Strafbarkeit des § 203 StGB. Die Gegenmeinung ist wiederum der Ansicht, dass das schriftliche Votum des Berichterstatters aufgrund seiner vorbereitenden Funktion nicht unter das Beratungsgeheimnis fällt, weshalb nach dieser Ansicht eine Strafbarkeit nach § 203 StGB ausscheidet.
Für die Ansicht, dass ein schriftliches Votum nicht unter das Beratungsgeheimnis fällt, spricht der vorbereitende Charakter, da das Votum noch keine endgültige Meinung eines einzelnen Richters bzw. des Gerichts über den Sachverhalt und die entscheidungserheblichen Rechtsfragen darstellt.[3]
Die Gegenseite ist der Überzeugung, dass das Votum dem Beratungsgeheimnis unterfallen müsse, da das Votum zwar keine endgültige Entscheidung mit Bindungswirkung darstellt, allerdings gewährt es sehr tiefe Einblicke in die Entscheidungsfindung der Kammer, auf jeden Fall aber in die Entscheidungsfindung des Berichterstatters.[4] Ebenso müsse die Grundlage, d.h. die Voten der Berichterstatter, geschützt werden, um einen freien, ergebnisoffenen Diskurs der Richter zu ermöglichen. [5]
Aufgrund des Bedürfnisses nach einem freien und ergebnisoffenen Diskurs und ihrer Argumente erscheint die zuletzt erläuterte Ansicht vorzugswürdig.
Darüber hinaus könnte die zur Verfügungstellung durch das Gericht eine Einwilligung in die Kenntnisnahme und die Offenbarung darstellen. § 203 Abs. 1 StGB setzt voraus, dass die Offenbarung des Geheimnisses unbefugt geschieht. Das bedeutet, dass der Tatbestand des § 203 Abs. 1 StGB nicht erfüllt ist, wenn der Offenbarende mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten handelt.[6] Dies scheitert bei einem richterlichen Votum, wenn man der Ansicht folgt, dass das Votum unter das Beratungsgeheimnis fällt. Es scheitert jedoch daran, dass weder der Berichterstatter noch der gesamte Spruchkörper frei über den Inhalt der Beratungen verfügen können.[7] Aus diesem Grund scheidet eine befugte Offenbarung aus.
Eine Strafbarkeit könnte trotz des auf den ersten Blick einschlägigen Wortlauts ausgeschlossen sein. In Betracht kommt, dass § 203 StGB teleologisch reduziert werden muss. Der Sinn und Zweck des § 203 StGB ist es, diejenigen zu schützen, die aufgrund ihrer Stellung zu einem anderen faktisch gezwungen sind, dem anderen private Informationen oder Geheimnisse anzuvertrauen.[8] Dieser faktische Offenbarungszwang fehlt in dem Fall, in dem das Gericht fälschlicherweise ein schriftliches Votum als Teil einer Akte übersendet.
Zudem erscheint es unsachgemäß, wenn ein Rechtsanwalt aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit strafrechtlich, also mit dem schärfsten Schwert des Staates, belangt wird, während der Mandant des Rechtsanwalts, der aufgrund der berufsrechtlichen Pflichten des Rechtsanwalts (§ 11 Abs. 1 S. 1 u. 2 BORA) ebenfalls Einsicht in die Gerichtsakten erhält, sich nicht strafbar macht. Weitergedacht könnte eine Person, die lediglich Prozesspartei und nicht jedoch Prozessvertreter ist, das Votum veröffentlichen, nicht aber ein Rechtsanwalt, der sich selbst vertritt. Dies würde insbesondere in Prozessen zu Ungewissheiten führen, in denen kein Anwaltszwang herrscht und sich ein Rechtsanwalt selbst vertritt.
Fazit:
In dem hier diskutierten Fall ist der Wortlaut bzw. der Tatbestand des § 203 Abs. 1 StGB einschlägig. Dennoch erscheint es vorzugswürdig, die Norm dahingehend teleologisch zu reduzieren, um unsachgemäße und willkürliche Entscheidungen zu verhindern.
[1] Einsiedler NJ 2014, S. 6, S. 12.
[2] BeckOK VwGO, Posser, § 100, Rn. 28; Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, § 100, Rn. 24; Einsiedler NJ 2014, S. 6, S. 13; Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, Sozialgerichtsgesetz/Keller, § 61, Rn. 10; Wysk, VwGO/Bamberger, § 100, Rn. 14; OVG Münster, Beschluss vom 20.10.1961 – IV A 252/61; a.A.: BVerwG NVwZ 1987, S. 127, Rn. 3; Sodan/Ziekow, VwGO/Kluckert, § 55, Rn. 68; OLG Frankfurt a.M., Beschluß vom 22. 12. 2006 – 7 W 77/06 – II. der Gründe.
[3] BVerwG NVwZ 1987, S. 127, Rn. 3.
[4] Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht/Rudisile, § 100, Rn. 24 f..
[5] Wysk, Verwaltungsgerichtsordnung/Bamberger, § 100, Rn. 14.
[6] Einsiedler NJ 2014, S. 6, S. 12.
[7] Einsiedler NJ 2014, S. 6, S. 9.
[8] MüKo StGB/Cierniak/Niehaus, § 203, Rn. 8.
So erreichen Sie meine Kanzlei in Brühl:
Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer
Fachanwalt für Medizinrecht und Versicherungsrecht
50321 Brühl
Tel. (02232) 50466-0
Fax (02232) 50466-19
info@dr-riemer.com
Felix Gehlen
Studentischer Mitarbeiter