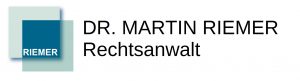Weitere Rechtsbeiträge
Mängelbeseitigungsanspruch – wie häufig darf der Verkäufer nachbessern?
Was bedeutet „unverzüglich“ im Sinne der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)?
Strafrecht: Darf ein Rechtsanwalt ein richterliches Votum veröffentlichen?
Welche datenschutzrechtlichen Probleme gibt es mit Google-Fonts?
Hochstapler – wenn der Schein trügt
Muster für einen notariellen Erbvertrag
Muster für eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde zur Meinungsfreiheit
Die Fahrerschutzversicherung – eine sinnvolle Ergänzung?
Mietvertrag – unzulässige automatische Verlängerung oder zulässiges Zeitmietverhältnis?
Frage: Wie ist ein Mietvertrag zu beurteilen, welcher folgende Klausel beinhaltet:
Das befristete Mietverhältnis beginnt am xxx und endet am xxx. Wenn nicht 3 Monate zuvor gekündigt wird, verlängert sich das Mietverhältnis um weitere 6 Monate.
Antwort: Das vorliegende Vertragsverhältnis endet nicht automatisch, sondern kann nur durch eine Kündigung beendet werden. Dadurch liegt kein Zeitmietverhältnis i.S.d. § 575 BGB vor, da bei diesem die ordentliche Kündigung ausgeschlossen ist.[1]
Die Klausel verstößt jedoch gegen § 573 c Abs. 4: Der Kündigungstermin wird abweichend vom Gesetz festgelegt. Es handelt sich um eine abweichende Regelung, die sich zum Nachteil des Mieters auswirkt. Sie ist demnach unwirksam.
Aber: Derartige Verträge, welche vor dem 1.9.2001 abgeschlossen wurden, sind jedoch nach der Ansicht des BGH dennoch wirksam.[2]
[1] Schmidt-Futterer/Lindner, 16. Aufl. 2024, BGB § 575 Rn. 81-85
[2] BGH NZM 2005, 417
Behandlungsfehler bei einer rechtswidrigen Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik – Worauf kann der Anspruch gestützt werden?
Die Anspruchsgrundlage für Ansprüche bei Behandlungsfehlern im Rahmen einer rechtswidrigen zwangsweisen Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik kommt nicht aus dem allgemeinen Deliktsrecht (§ 823 BGB).
Es kommt vielmehr ein Amtshaftungsanspruch gemäß §§ 839, 253 BGB i.V.m. Art. 34 GG aufgrund einer Amtspflichtverletzung in Betracht.
Denn die Unterbringung wird gerichtlich angeordnet – sie kann nicht privatrechtlich erfolgen.
Nach Art. 34 GG haftet der Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst der Amtsträger steht, für das rechtswidrige öffentlich-rechtliche Handeln.
Anhörung eines Privatsachverständigen
Ein Privatsachverständigen kann im Rahmen der mündlichen Verhandlung hinzugezogen werden.
Die Partei kann sich von ihm beraten lassen. Zudem kann sie ihm das Fragerecht übertragen.
Außerdem kann der Sachverständige als Nebenintervenient eigene Recht ausüben (§ 67 ZPO).[1]
[1] BGH vom 14.10.2008 VI ZR 7/08
Das Steuergeheimnis - Finanzbeamte als Zeugen vor Gericht
Das Steuergeheimnis gemäß § 30 AO schützt die Vertraulichkeit der steuerlichen Daten und Informationen.
Steuerberater, Finanzbeamte und andere Personen, die mit steuerlichen Angelegenheiten befasst sind, ist es nicht gestattet, diese Daten unbefugten Dritten zugänglich machen.
Die Daten müssen vertraulich behandelt und dürfen nur im Rahmen gesetzlicher Vorschriften verwendet werden.
Die Pflicht zur Wahrung des Steuergeheimnisses gilt auch dann, wenn ein Finanzbeamter vor Gericht aussagt.
Im Bezug auf die Aussage bedarf es generell einer Genehmigung durch den Dienstvorgesetzten (§ 37 BeamtenG).
Für die Befugnis, steuerrechtliche Aspekte zu offenbaren, gilt § 30 Abs.4 und 5 AO. Dabei wird nach der Art des gerichtlichen Verfahrens differenziert.
Gemäß § 30 Abs. 4 Nr.1 ist eine Offenbarung nur zulässig, soweit die Verhältnisse von Dritten eine unmittelbare Bedeutung für die Entscheidung im finanzgerichtlichen Verfahren haben.
Jedoch muss es sich um ein zivilgerichtliches Verfahren in Steuersachen handeln (§ 30 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 30 Abs. 2 Nr. 1 lit. a)).
Sollte der Beamte im Bezug auf seine Offenbarungsbefugnis Zweifel haben, so darf und muss er keine Auskunft zu der entsprechenden Frage erteilen.
Zudem kann der Betroffene der Offenbarung zustimmen.
Sollte die Aussage in der Rolle als Sachverständiger ergehen, gelten diese Grundsätze entsprechend.
LfSt Niedersachsen, Verfügung v. 29.7.2019, S 0130 – 305 – St 142
Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung (GoP)
Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung (GoP) sind Regeln für die korrekte Dokumentation von Geschäftsvorfällen.
Durch diese soll Nachvollziehbarkeit, Sicherheit, Klarheit, Richtigkeit und Vollständigkeit gewährleistet werden.
Quellen:
- Gesetz- und Rechtsprechung:
- a) Handelsrecht (§§ 238–263 HGB)
- b) Steuerrecht (§§ 140–148, 154, 158 AO; §§ 4 ff. EStG; R 5.2 EStR)
- c) Rechtsprechung.
- Empfehlungen, Erlasse, Gutachten von Behörden und Verbänden.
- Gepflogenheiten der Praxis.
Grundsätze:
- Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit (Nachprüfbarkeit)
- Einem sachverständigen Dritten soll in einer angemessenen Zeit ein Überblick unter anderem über die Entstehung und Abwicklung von Geschäften verschafft werden.
- Grundsatz der Vollständigkeit
- Die Buchführung muss lückenlos erfolgen.
- Grundsatz der Einzelbewertung
- Die Vermögensgegenstände müssen einzeln bewertet werden.
- Belegprinzip
- Jedem Geschäftsvorfall muss ein Beleg zugrunde liegen.
- Grundsatz der rechtzeitigen und geordneten Buchung
- Alle Geschäftsvorfälle müssen zeitnah und chronologisch verbucht werden.
- Aufbewahrungsfrist für Bücher und Buchungsbelege beträgt zehn Jahre (§ 257 IV HGB)
- Eine ordnungsgemäße Archivierung muss erfolgen.
Seit dem 1.1.2025 müssen überdies E-Mails von Eingangsrechnungen revisionssicher archiviert werden.
Frage: Muss das gesamte E-Mail Postfach revisionssicher archiviert werden?
Nein, es muss nicht jede E-Mail im Postfach archiviert werden, sondern nur diejenigen, welche geschäftliche Vorgänge umfassen.
- Nur Rechnungen oder anderweitige E-Mails mit steuerrechtlichem Bezug
Quellen: https://easy-software.com/de/newsroom/e-mail-archivierung/
https://www.d-velop.de/blog/compliance/e-mail-archiv/
https://www.lexware.de/wissen/buchhaltung-finanzen/e-mail-archivierung/
https://www.haufe.de/id/beitrag/grundsaetze-ordnungsmaessiger-buchfuehrung-nach-hgb-2-dokumentationsgrundsaetze-HI9892619.html
Wohnsitz des Schuldners im Ausland – Möglichkeit der Zwangsvollstreckung?
Antwort: Ja, ein deutsches Urteil wird wie eine nationale Entscheidung des Vollstreckungsstaates behandelt.
Voraussetzungen:
- Ein in Deutschland vollstreckbarer Titel
- Bescheinigung nach Art. 53 Brüssel Ia-VO, ausgestellt von dem Ursprungsgericht (§ 1110 ZPO)
- Die Unterlagen müssen dem Schuldner zugestellt werden -> dies erfolgt idR über den ausländischen Gerichtsvollzieher
aber: vollstreckt werden kann jedoch nur in Vermögen, dass sich tatsächlich in dem jeweiligen Land befindet